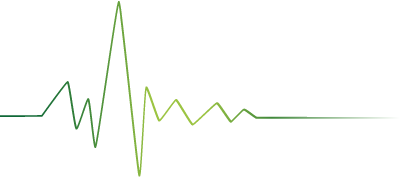Die Gesetzlichen Krankenversicherungen nehmen sowohl als Unternehmen als auch zentrale Kostenträger im deutschen Gesundheitssystem eine wichtige Rolle im Diskurs über ein nachhaltiges Gesundheitswesen ein. Das Gespräch über eigene Überzeugungen, Initiativen und Forderungen führte Jürgen Graalmann.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz waren lange „Orchideenthemen“. Warum haben es diese Themen im Gesundheitswesen weiterhin so schwer?

Christoph Straub: Es ist auch für mich überraschend, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Gesundheitswesen bisher eine untergeordnete Rolle spielen. Der Klimawandel stellt ein enormes Gesundheitsrisiko dar – global und national. Hitzewellen und starke Temperatursprünge führen unmittelbar zu mehr Krankenhauseinweisungen, überlasteten Notaufnahmen und letztlich mehr Todesfällen. So starben in den Hitzesommern 2003, 2006 und 2015 jeweils 6.000 bis 7.500 Menschen zusätzlich an den Folgen der Hitzebelastung. Außerdem werden in solchen Phasen Nierenerkrankungen wahrscheinlicher, es kommt zu mehr Frühgeburten und Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen leiden unter der höheren Ozonkonzentration. Obwohl das Gesundheitssystem ein besonderes Interesse an gesunden Lebensbedingungen haben muss und es mit rund fünf Prozent nennenswert zum Treibhausgasausstoß beiträgt, gibt es bisher zu wenig Aufmerksamkeit für diesen Zusammenhang. Deshalb existiert für das Gesundheitswesen bisher auch keine gemeinsame Agenda aller Akteure, die den Weg hin zur Klimaneutralität für das gesamte System aufzeigt.
Der Klimawandel stellt ein enormes Gesundheitsrisiko dar.
Andrea Galle: Generell spiegeln sich aus meiner Sicht so gut wie alle gesellschaftlich relevanten Themen auch im Gesundheitswesen wider – sei es die Digitalisierung, New Work oder Corona. Aktuell befassen wir uns zudem intensiv mit der künftigen Finanzierung der GKV.
Wir selbst arbeiten seit über zehn Jahren informell und seit 2016 strategisch an der Integration von Nachhaltigkeit in alle Bereiche der BKK VBU. In den ersten Jahren war es eine große Herausforderung, Mitstreiter im System zu finden. Umso erfreulicher ist es, dass die Aufmerksamkeit für das Thema in den letzten zwei Jahren einen riesigen Sprung gemacht hat.
Heute gehen auch andere Kassen erste Schritte, es sind neue Kooperationspartner in der Zivilgesellschaft wie KLUG und die Stiftung GEGM entstanden, mit denen wir gemeinsam Projekte realisieren. Als stolzes Gründungsmitglied und aktiver Treiber der „Green Health“-Initiative des BKK-Dachverbands kooperieren wir eng mit anderen Betriebskrankenkassen und entwickeln „Nachhaltigkeit in der GKV“ gemeinsam weiter. Seit ein paar Monaten scheint das Thema auch langsam in Politik und Aufsicht anzukommen. Aber insgesamt gibt beim Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen noch sehr viel Luft nach oben.
Nachhaltigkeit hat als Begriff viele Facetten. Was ist Ihre Definition?
Christoph Straub: Die Nachhaltigkeitsstrategie der BARMER orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Dahinter steht also ein weiter Begriff von Nachhaltigkeit – ökologisch, ökonomisch und sozial. Auf acht dieser 17 Ziele legen wir einen besonderen Fokus. Neben dem Klima zählen dazu etwa die Geschlechtergleichstellung oder unsere Rolle als starke Institution im Gesundheitswesen, von der zu Recht Transparenz und Krisenfestigkeit erwartet wird. Eine herausgehobene Stellung innerhalb der Strategie hat der Klimaschutz, eben weil die Gesundheit der Menschen unsere Kernaufgabe ist und der Klimawandel eine zentrale Bedrohung für die Gesundheit darstellt.
 Andrea Galle: Nachhaltigkeit ist im Kern erst einmal eine innere Einstellung zu Umwelt, Mensch, Natur, unseren Ressourcen und der Verantwortung, damit gewissenhaft umzugehen, dauerhaft und zukunftsorientiert. Ich will den Begriff nicht überstrapazieren und auch nicht ausschließlich auf ökologische Aspekte reduzieren. Bei der BKK VBU haben wir bewusst das CSR-Konzept gewählt – mit all der konzeptionell verankerten Bandbreite, die sich heute auch in der ESG-Debatte abbildet: Eine Verantwortung für Umwelt, Mitarbeitende, Kunden, Gesellschaft und Geschäftstätigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, eine konsequent patientenorientierte und ressourcenschonende Versorgung. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt birgt das Potenzial, mehr Qualität in der Versorgung für alle sicherzustellen und dabei effizienter und ressourcenschonender zu agieren. Eine patientenzentrierte Versorgung, die zudem geschlechtssensibel ausgerichtet ist, wird durch bessere Behandlungserfolge – wie heute bereits in der Präzisionsmedizin zu sehen – und damit verbundener Lebensqualität langfristig immense Kosten und Ressourcen sparen. Das ist aus meiner Sicht zukunftsorientiert und nachhaltig.
Andrea Galle: Nachhaltigkeit ist im Kern erst einmal eine innere Einstellung zu Umwelt, Mensch, Natur, unseren Ressourcen und der Verantwortung, damit gewissenhaft umzugehen, dauerhaft und zukunftsorientiert. Ich will den Begriff nicht überstrapazieren und auch nicht ausschließlich auf ökologische Aspekte reduzieren. Bei der BKK VBU haben wir bewusst das CSR-Konzept gewählt – mit all der konzeptionell verankerten Bandbreite, die sich heute auch in der ESG-Debatte abbildet: Eine Verantwortung für Umwelt, Mitarbeitende, Kunden, Gesellschaft und Geschäftstätigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, eine konsequent patientenorientierte und ressourcenschonende Versorgung. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt birgt das Potenzial, mehr Qualität in der Versorgung für alle sicherzustellen und dabei effizienter und ressourcenschonender zu agieren. Eine patientenzentrierte Versorgung, die zudem geschlechtssensibel ausgerichtet ist, wird durch bessere Behandlungserfolge – wie heute bereits in der Präzisionsmedizin zu sehen – und damit verbundener Lebensqualität langfristig immense Kosten und Ressourcen sparen. Das ist aus meiner Sicht zukunftsorientiert und nachhaltig.
Herr Straub, die BARMER hat 2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht und strebt an, bereits zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Wie wollen Sie das schaffen?
 Christoph Straub: Die BARMER treibt seit vielen Jahren Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Unternehmen voran. Mittlerweile haben wir es als erste große Krankenkasse geschafft, an allen Standorten klimaneutral zu arbeiten. Darauf sind wir stolz. Aber seien wir ehrlich: Der ökologische Fußabdruck einer Krankenkasse ist vergleichsweise klein – wir betreiben keine Produktionsanlagen und haben keine ressourcenintensive Logistik. Trotzdem stehen wir gerade als Krankenkasse in der Pflicht, alles dafür zu tun, selbst CO2 zu vermeiden. Bereits im Jahr 2021 hat die BARMER ihren CO2-Ausstoß gegenüber 2019 um 39 Prozent reduziert. Einen Teil der Emissionen gleichen wir durch klimafreundliche Projekte aus. Ein wesentlicher Hebel für weitere Kohlendioxideinsparungen sind Potenziale im Bereich Gebäudemanagement. Die BARMER nutzt bereits zu 100 Prozent Ökostrom, und in den nächsten Jahren werden wir den CO2-Ausstoß beispielsweise durch Flächenreduktion und Sanierung kontinuierlich senken. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Mobilität unserer Mitarbeitenden, wie Dienstreisen und Arbeitswege. Durch Homeoffice-Möglichkeiten reduzieren wir die Summe der zurückgelegten Kilometer und schaffen mit Leasing-Fahrrädern oder Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr zusätzlich Anreize für die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Digitalisierung und damit verbunden die kontinuierliche Reduktion der enormen Papiermengen, die im Gesundheitswesen noch verbraucht und verschickt werden. Mindestens genauso wichtig wie unsere Bemühungen um eine klimaneutrale BARMER sind aber unsere Anstrengungen, eine Veränderung im gesamten Gesundheitssystem voranzutreiben.
Christoph Straub: Die BARMER treibt seit vielen Jahren Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Unternehmen voran. Mittlerweile haben wir es als erste große Krankenkasse geschafft, an allen Standorten klimaneutral zu arbeiten. Darauf sind wir stolz. Aber seien wir ehrlich: Der ökologische Fußabdruck einer Krankenkasse ist vergleichsweise klein – wir betreiben keine Produktionsanlagen und haben keine ressourcenintensive Logistik. Trotzdem stehen wir gerade als Krankenkasse in der Pflicht, alles dafür zu tun, selbst CO2 zu vermeiden. Bereits im Jahr 2021 hat die BARMER ihren CO2-Ausstoß gegenüber 2019 um 39 Prozent reduziert. Einen Teil der Emissionen gleichen wir durch klimafreundliche Projekte aus. Ein wesentlicher Hebel für weitere Kohlendioxideinsparungen sind Potenziale im Bereich Gebäudemanagement. Die BARMER nutzt bereits zu 100 Prozent Ökostrom, und in den nächsten Jahren werden wir den CO2-Ausstoß beispielsweise durch Flächenreduktion und Sanierung kontinuierlich senken. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Mobilität unserer Mitarbeitenden, wie Dienstreisen und Arbeitswege. Durch Homeoffice-Möglichkeiten reduzieren wir die Summe der zurückgelegten Kilometer und schaffen mit Leasing-Fahrrädern oder Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr zusätzlich Anreize für die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Digitalisierung und damit verbunden die kontinuierliche Reduktion der enormen Papiermengen, die im Gesundheitswesen noch verbraucht und verschickt werden. Mindestens genauso wichtig wie unsere Bemühungen um eine klimaneutrale BARMER sind aber unsere Anstrengungen, eine Veränderung im gesamten Gesundheitssystem voranzutreiben.
Frau Galle, Als eine der ersten deutschen Krankenkassen haben Sie 2016 eine CSR-Managerin eingestellt und 2019 einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex vorgelegt. Was war der Anlass für Ihr frühes Engagement?
 Andrea Galle: Wie meine Eltern habe ich einen Großteil meiner Kindheit auf dem Land verbracht und damit von vornherein ein anderes Verhältnis zur Natur. Ich bin im Osten aufgewachsen und da waren die Ressourcen auch eher knapp. Als wir vor 30 Jahren die BKK VBU aufbauten, ging das für mich mit unternehmerischer Verantwortung einher. Wir haben früh mit den Mitarbeitenden daran gearbeitet, die Kasse so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Es wurden gemeinsam Ideen generiert und umgesetzt, zum Beispiel mit Blick auf Medikamentenmüll, die Umstellung unserer Standorte auf Ökostrom oder nachhaltige Anlageformen für die betriebliche Altersvorsorge. Dann brauchten wir jemanden, der alle Ideen zusammenführt und koordiniert – das ist sein 2016 unsere CSR-Managerin, Dorothee Christiani. Heute haben wir eine CSR-Strategie und -Reporting implementiert, ein Umweltmanagement, Mobilitätskonzepte und ein standortübergreifendes System aus CSR-Botschaftern geschaffen. Wir wollen uns immer möglichst früh neue Themen für uns als gesetzliche Krankenkasse erschließen. Da profitieren wir von kurzen Entscheidungswegen. Und, ganz persönlich: Ich mag keine halben Sachen. Wir denken mehrdimensional. Uns geht es um Betriebsführung im Allgemeinen, um die Beschäftigten, unsere Branche, unser Verhältnis zu unseren Kunden, um Ressourcen, aber auch um Haltung. Denn schließlich sind gesetzliche Krankenkassen Teil des sozialen Gemeinwesens und können hier nachhaltig wirken. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Unternehmerische Verantwortung ist kein Projekt, das irgendwann abgeschlossen ist. Wir wollen und müssen einen ressourcensensiblen Umgang in alle Produkte und Geschäftsprozesse integrieren. Auch in Bezug auf die Digitalisierung spielt das eine entscheidende Rolle. Mit der Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs über Green IT bis hin zu Datenethik und Corporate Digital Responsibility (CDR) liegen spannende Themen vor uns. Wir wollen unsere Ziele nachjustieren, unser Umweltmanagement weiter professionalisieren, umfassendere Erfolgskennzahlen festlegen und konkrete Einsparpotenziale durch Digitalisierung stärker erfassen und heben. Konkret werden wir unsere Leistungen und Präventionsmaßnahnahmen auf den Klimawandel vorbereiten und so viel Kraft wie möglich in die Verhinderung klimabedingter Gesundheitsfolgen stecken.
Andrea Galle: Wie meine Eltern habe ich einen Großteil meiner Kindheit auf dem Land verbracht und damit von vornherein ein anderes Verhältnis zur Natur. Ich bin im Osten aufgewachsen und da waren die Ressourcen auch eher knapp. Als wir vor 30 Jahren die BKK VBU aufbauten, ging das für mich mit unternehmerischer Verantwortung einher. Wir haben früh mit den Mitarbeitenden daran gearbeitet, die Kasse so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Es wurden gemeinsam Ideen generiert und umgesetzt, zum Beispiel mit Blick auf Medikamentenmüll, die Umstellung unserer Standorte auf Ökostrom oder nachhaltige Anlageformen für die betriebliche Altersvorsorge. Dann brauchten wir jemanden, der alle Ideen zusammenführt und koordiniert – das ist sein 2016 unsere CSR-Managerin, Dorothee Christiani. Heute haben wir eine CSR-Strategie und -Reporting implementiert, ein Umweltmanagement, Mobilitätskonzepte und ein standortübergreifendes System aus CSR-Botschaftern geschaffen. Wir wollen uns immer möglichst früh neue Themen für uns als gesetzliche Krankenkasse erschließen. Da profitieren wir von kurzen Entscheidungswegen. Und, ganz persönlich: Ich mag keine halben Sachen. Wir denken mehrdimensional. Uns geht es um Betriebsführung im Allgemeinen, um die Beschäftigten, unsere Branche, unser Verhältnis zu unseren Kunden, um Ressourcen, aber auch um Haltung. Denn schließlich sind gesetzliche Krankenkassen Teil des sozialen Gemeinwesens und können hier nachhaltig wirken. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Unternehmerische Verantwortung ist kein Projekt, das irgendwann abgeschlossen ist. Wir wollen und müssen einen ressourcensensiblen Umgang in alle Produkte und Geschäftsprozesse integrieren. Auch in Bezug auf die Digitalisierung spielt das eine entscheidende Rolle. Mit der Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs über Green IT bis hin zu Datenethik und Corporate Digital Responsibility (CDR) liegen spannende Themen vor uns. Wir wollen unsere Ziele nachjustieren, unser Umweltmanagement weiter professionalisieren, umfassendere Erfolgskennzahlen festlegen und konkrete Einsparpotenziale durch Digitalisierung stärker erfassen und heben. Konkret werden wir unsere Leistungen und Präventionsmaßnahnahmen auf den Klimawandel vorbereiten und so viel Kraft wie möglich in die Verhinderung klimabedingter Gesundheitsfolgen stecken.
Unternehmerische Verantwortung ist kein Projekt, das irgendwann abgeschlossen ist.
Kassen forderten bereits Nachhaltigkeit in das SGB aufzunehmen. Wie stehen Sie dazu, Nachhaltigkeit als Klammer um die sozialrechtlichen Leitprinzipien – Zugang, Wirtschaftlichkeit, Qualität – zu denken?
Andrea Galle: Grundsätzlich sind wir für weniger statt mehr neue Auflagen im SGB. Einen offiziellen Auftrag zu umweltverträglichem Wirtschaften würden wir aber sehr begrüßen, da uns das viele kraftraubende Debatten ersparen und dem Thema im System eine höhere Priorität einräumen würde. Mir geht es aber um einen Kulturwandel – weg von der Verbotskultur hin zu einer Ermutigungskultur auch für die GKV. Wir brauchen weniger Bürokratie und Überregulierung. Politik sollte den Rahmen für mehr Gestaltungsspielräume geben. Aktuell wirkt alles sehr bevormundend und kleinkariert – das Vertrauen in die Akteure scheint abhandengekommen. Die Krankenkassen sollten wieder mehr als Experten wahr- und ernstgenommen werden. Wir sind nicht das zu regulierende Problem, sondern ein maßgeblicher Teil der Lösung. Ein großer Fortschritt wäre eine Änderung des § 30 SGB IV, nach dem Krankenkassen alles verboten ist, was nach dem Gesetz nicht ausdrücklich erlaubt ist. Dazu gehört auch – nur vermeintlich im Gegensatz zum gerade beschriebenen – für alle staatlichen und nachgelagerten Behörden die Anforderung zu formulieren, ressourcenschonendes Wirtschaften zu priorisieren. Das würde viele faktische und theoretische Steine in den Köpfen auf allen Ebenen zur Seite schieben. Der Gesundheitsbegriff ist breiter als nach SGB V. Gesunde Menschen brauchen ein gesundes Umfeld und eine gesunde Umwelt. Ich wünsche mir, dass sich unser Gesundheitswesen weiter in Richtung dieser existenziellen Überzeugung öffnet und die Verantwortlichen in die Lage versetzt, Ressourcen zu schonen und Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen. Der Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit ist nicht mehr zu leugnen, weshalb ein zum Klimaschutz beitragendes Gesundheitswesen auch einen direkten Patientennutzen hat. Mir gefällt der Begriff der sozialrechtlichen Leitprinzipien – hiermit könnten Prinzipien stärkere Bedeutung erlangen, die einer nachhaltigen Aufstellung des Gesundheitswesens dienlich sind, zum Beispiel konsequent krankheitsvermeidend, konsequent ambulant vor stationär, konsequent digital und datennutzend zum Patientenwohl, konsequent patientenzentriert und geschlechtssensibel, konsequent müllvermeidend und klimaneutral.
Christoph Straub: Ich unterstütze diesen Ansatz ausdrücklich. Wir werden ein klimaneutrales Gesundheitswesen nicht zum Nulltarif bekommen. Viele Maßnahmen zum Klimaschutz sind zugleich wirtschaftlich nachhaltig, beispielsweise das Einsparen von Energie. Es gibt aber genauso viele Beispiele, wo klimafreundliche Lösungen mehr kosten oder zunächst Investitionen nötig sind, die sich erst mittelfristig amortisierend. Nachhaltigkeit sollte Grundbedingung des Verwaltungshandelns sein und entsprechend im SGB verankert werden. Das ermöglicht es Krankenkassen, den Weg aktiv mitzugestalten. Ich sehe allerdings noch weitere wichtige Ansatzpunkte im Sozialrecht. Neben der Frage, wie das Gesundheitswesen klimafreundlicher werden kann, muss es sich auch stärker als bisher darauf einstellen, den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zu begegnen – beispielsweise mit Prävention und Gesundheitsförderung.
Welche nächsten Schritte müssen für ein nachhaltiges Gesundheitswesen gegangen werden?
Christoph Straub: Das Thema nachhaltiges Gesundheitswesen muss in Politik und Selbstverwaltung deutlich höher priorisiert werden. Wir brauchen eine gemeinsame Agenda für ein klimaneutrales Gesundheitswesen, die Leistungserbringende, Kostenträger und Produzenten gleichermaßen einbezieht. Solange es ein Nischenthema bleibt, wird nichts passieren. Außerdem müssen Hürden in der Gesetzgebung beseitigt werden, die heute klimafreundliches Handeln erschweren. Stattdessen muss der Gesetzgeber Anreize schaffen sowie Bund und Länder ihre Fördermittelvergaben konsequent an Nachhaltigkeitskriterien knüpfen. Und schließlich muss die Digitalisierung dringend beschleunigt werden. Hier gehen Klimaschutz und wirtschaftliche Nachhaltigkeit unmittelbar Hand in Hand. Eine zügige, konsequente Digitalisierung könnte jedes Jahr Milliarden Euro und Millionen Tonnen CO2 im Gesundheitswesen einsparen.
Andrea Galle: Wir brauchen einen neuen Blick auf Leben, Gesundheit und Krankheit und müssen auf die ganze Kette der Gesundheitsversorgung schauen. Wenn wir eine – für alle Menschen hochwertige und in die Zukunft orientierte – Versorgung möchten, braucht es ein grundlegendes Neudenken – und dafür sollten wir, das Wortspiel sei gestattet, Grundlegendes neu denken. Die Prävention wird hier in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen! Keine medizinische Behandlung kann so gut und schonend für Mensch und Umwelt sein wie die Vermeidung einer Erkrankung. Wir müssen konsequenter auf Krankheitsvermeidung setzen und dies auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen. Wir Krankenkassen bringen dafür das nötige Knowhow mit und können einen wesentlichen Beitrag leisten. Nachhaltigkeitsbestrebungen kann es nur im Zusammenspiel mit Strukturreformen geben und umgekehrt. Wir müssen uns immer wieder fragen: Tun wir die Dinge richtig oder die richtigen Dinge?