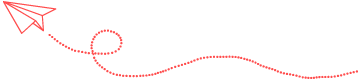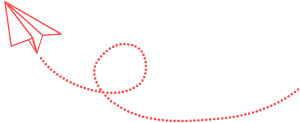„Dr. Google“: Integrieren statt ignorieren
Die Reform des Gesundheitssystems bringt viele Herausforderungen mit sich, und eine der größten ist die Digitalisierung der Gesundheitskommunikation. Das Internet als Informations- und Kommunikationsmedium ist heute aus der Gesundheitskommunikation nicht mehr wegzudenken. Menschen nutzen das Internet, um sich über Symptome und Ursachen von Krankheiten zu informieren, um Arztpraxen zu finden und Termine zu vereinbaren, um Selbsthilfegruppen zu kontaktieren und sich in Foren mit anderen Betroffenen auszutauschen. Aber auch ohne aktiv danach zu suchen, stoßen Internetnutzer:innen auf eine Vielfalt an Gesundheitsinformationen, bei der Lektüre von Zeitungen oder Zeitschriften, aber zunehmend auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube. Manche dieser Informationen wurden von journalistischen Redaktionen nach bestimmten Qualitätsstandards aufbereitet, aber viele andere werden von Unternehmen und Organisationen verbreitet, deren (meist kommerzielle) Interessen nicht für jede/n auf Anhieb ersichtlich sind. Und schließlich ermöglicht das Internet auch einzelnen Nutzer:innen, ihre Erfahrungen und Meinungen mit anderen zu teilen, mit dem engsten Familien- und Freundeskreis, aber nicht selten auch mit einem recht großen Publikum. Die Grenzen zwischen Individual- und Massenkommunikation, zwischen privater und öffentlicher Kommunikation verschwimmen im Internet zusehends, und diese Entwicklung betrifft auch die Gesundheitskommunikation.
„Die Grenzen zwischen privater Individual- und öffentlicher Massenkommunikation verschwimmen zusehends, und das betrifft auch die Gesundheitskommunikation.“
Zwar sind das persönliche Gespräch mit dem Arzt bzw. der Ärztin oder auch mit Bekannten und Angehörigen sowie die klassischen Medien (Rundfunk, Tageszeitungen, Magazine, Special-Interest-Zeitschriften) immer noch die wichtigsten Informationsquellen beim Thema Gesundheit. Auch Informationsmaterial, das von Krankenkassen und Apotheken kostenlos verbreitet wird, spielt eine entscheidende Rolle. Das Internet wird für die Bürger:innen jedoch zu einer wichtiger werdenden Quelle für Gesundheitsinformationen. Gesundheitskommunikation in digitalen Medien erschöpft sich allerdings nicht in der Vermittlung von gesundheitsrelevantem Wissen, sondern bedeutet auch Dialog und Interaktion: zwischen Expert:innen und Laien, von Patient:in zu Patient:in sowie zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Patient:innen suchen nicht nur allgemeine Informationen, sondern auch Antworten auf ihre persönlichen Fragen und Probleme. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen suchen im Netz nicht nur nach Informationen, sondern auch Räume, in denen sie soziale Unterstützung erfahren und ihre persönliche Expertise weitergeben können. Das Internet ist längst nicht mehr nur ein leicht zugängliches Informationsmedium, sondern für viele auch ein unverzichtbares Instrument des Selbstmanagements, und kann als solches auch zu einem wichtigen Faktor für den Therapieerfolg bzw. das Erreichen von Public-Health-Zielen werden.
„Das Internet wird nicht nur als Quelle von Gesundheitsinformationen, sondern auch als Instrument des Selbstmanagements wichtiger“
Die persönliche Aufklärung und Beratung durch den Arzt bzw. die Ärztin bleiben unverzichtbar. Es ist jedoch wichtig, dass die Ärzteschaft sowie das Pflegepersonal sich darauf einstellen, dass die Patient:innen bereits Vorwissen mitbringen bzw. nach der Konsultation weitere offene Fragen mithilfe des Internets zu klären versuchen. Vor allem im Studium und in der Ausbildung im Medizinsektor gilt es, die Nutzung und Wirkung von Gesundheitskommunikation stärker zu berücksichtigen und in die Arzt-Patienten-Kommunikation einzubinden. Schließlich gibt die gesundheitsbezogene Mediennutzung der Patient:innen auch Auskunft über ihre Probleme, ihren Leidensdruck, aber auch ihre Motivation, aktiv an der Heilung bzw. Besserung ihrer Lage mitzuwirken.
Auch wenn die Vorteile des Internets auf der Hand liegen, sehen viele Ärzte und Ärztinnen die Online-Recherche ihrer Patient:innen mit Skepsis. Tatsächlich wenden sich Patient:innen, die unzufrieden mit der Arzt-Patienten-Kommunikation sind, eher Online-Angeboten zu, um ihren Informations- oder Kommunikationsbedarf zu decken. Zugleich trägt das Internet aber auch dazu bei, dass Patient:innen besser informiert sind und dann auch aktiver an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Ärzte und Ärztinnen sollten sich nicht nur damit abfinden, dass ihre Patient:innen vor oder nach dem Arztbesuch auf die Suche nach Informationen gehen, sondern sie sollten ihre Patient:innen aktiv darauf ansprechen, falsche Informationen korrigieren und offene Fragen klären. Das Internet sollte nicht als Konkurrenz aufgefasst werden, sondern in die vertrauens- und respektvolle Arzt-Patienten-Kommunikation miteinbezogen werden. Daher ist es ratsam, wenn Ärzte und Ärztinnen qualitativ hochwertige Informationsangebote kennen und empfehlen, z.B. Hintergrundinformationen, Übungsvideos oder praktische Tipps, die den Patient:innen helfen, ihre Ernährung oder ihren Lebenswandel ihren gesundheitlichen Bedürfnissen entsprechend anzupassen.