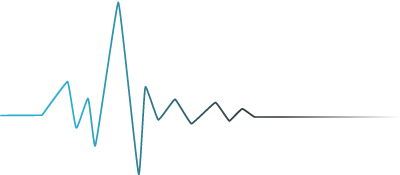Die digitale Transformation ist in zahlreichen Branchen bereits weitgehend vorangeschritten – das Gesundheitswesen hinkt nach wie vor hinterher. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode gleichsam einen Sprint vollzogen, um diesen Rückstand zumindest zu verringern. Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das am 19. Dezember 2019 in Kraft trat, wurden die Weichen für innovative Gesundheitsleistungen gestellt, die Deutschland weltweit in eine Vorreiterrolle bringen: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) können offiziell von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden und treten somit als neuer Therapiebaustein an die Seite von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Mit dem sogenannten DiGA-Fast-Track-Verfahren sorgte die Politik zudem dafür, dass das hohe Tempo, das sie selbst vorgelegt hat, nicht auf dem steinigen Pfad durch die Gremien der Selbstverwaltung gedrosselt wird. Gut zehn Monate nach Inkrafttreten des DVG gelangten die ersten beiden DiGA in die Erstattungsfähigkeit – für das deutsche Gesundheitswesen ist das Rekordzeit. Mittlerweile wurden 20 Anwendungen in das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgenommen (Stand Ende August 2021).
Mehr Patientenorientierung, mehr Teilhabe am Versorgungsprozess sowie eine stärker personalisierte und individualisierte Medizin zählen zu den wichtigsten Vorteilen, die man sich von der digitalen Transformation des Gesundheitswesens verspricht. Zudem kann die Sammlung und Auswertung von Daten langfristig enorm zur Versorgungsverbesserung beitragen. Nicht zuletzt spielen die Vernetzung und die Entlastung von Leistungserbringenden eine wichtige Rolle: Denn angesichts des demografischen Wandels, der Zunahme von Multimorbidität und des Fachkräftemangels führt auch im Gesundheitswesen kein Weg daran vorbei, Effizienzgewinne mithilfe von digitalen Lösungen zu realisieren. DiGA bilden in der Gesamtstrategie eine Komponente der digitalen Transformation, die vor allem eine stärkere Einbindung der Patientinnen und Patienten unterstützen kann.
Noch immer die höchsten Hürden der Digitalisierung: Datenschutz und mangelnde Akzeptanz bei den Leistungserbringenden
Die Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren der DiGA können nicht losgelöst vom Gesamtkontext der digitalen Transformation im Gesundheitswesen betrachtet werden. Befragt nach den drei größten Herausforderungen von Digital Health liegen nach wie vor die Klassiker an der Spitze: 54% sehen Datenschutz und Datensicherheit als kritisches Thema, gefolgt von der Akzeptanz der Leistungserbringenden mit 49% und der technischen Infrastruktur auf Unternehmens- und Systemebene mit 47% (s. Abb. 1).
Digitalunternehmen als stärkste Treiber, Patientinnen und Patienten als größte Profiteure von Digital Health
Als stärkste Treiber der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden mit 84% eindeutig Digitalisierungsunternehmen gesehen. Die Politik erreicht mit 57% immerhin Rang zwei, während Krankenkassen mit 40% auf Platz drei stehen. Die geringste Schubkraft geht nach Einschätzung der Befragten von den Ärztinnen und Ärzten aus (4%). Auch dieses Ergebnis liefert Hinweise auf die Gemengelage, in der die DiGA sich aktuell wiederfindet: Die Hersteller drängen mit Elan und Innovationskraft in den Markt – über ein mangelndes Angebot an DiGA braucht man sich also kaum zu sorgen. Mitgenommen werden müssen dagegen die Ärztinnen und Ärzte, die gleichsam als Flaschenhals zwischen den Herstellern und den „Endkunden“ – sprich: den Patientinnen und Patienten – fungieren.
Den größten Nutzen von Digital-Health-Lösungen verorten die Befragten klar bei den Patientinnen und Patienten (83%), mit einigem Abstand gefolgt von den Ärztinnen und Ärzten (51%). Die Leistungserbringenden selbst sehen als Profiteure allerdings eher Krankenkassen sowie IT-Unternehmen und weitere Hersteller von Digital-Health-Lösungen (im Folgenden Digitalunternehmen genannt); erst auf den Plätzen vier und fünf folgen in ihren Augen Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser (s. Abb. 2).
Hohe Nutzungsbereitschaft, kaum Zweifel am gesundheitlichen Mehrwert
Mit 93 % gibt fast jeder unter den Umfrageteilnehmenden an, dass sie im Rahmen der eigenen Behandlung eine DiGA nutzen würden, wenn ihre Ärztin oder ihr Arzt dies empfiehlt (s. Abb. 3). Ohne ärztliche Empfehlung können sich immerhin noch mehr als drei von vier Befragten (78%) vorstellen, eine DiGA bei ihrer Krankenkasse zu beantragen.
Kein DiGA-Markterfolg ohne Evidenz und strukturelle Einbindung
Als wichtigste Bausteine zur Förderung der Marktdurchdringung von DiGA sehen die Befragten über alle Tätigkeitsfelder des Gesundheitswesens hinweg die Generierung und Kommunikation von Evidenz und die Aufnahme in Behandlungsleitlinien (je 58%). Zudem wählten sie die Schulung der Leistungserbringenden (45%) unter die Top-3-Maßnahmen zur Förderung der DiGA-Verbreitung (s. Abb. 5).
Schulung der Versorgenden: der Türöffner zur DiGA-Nutzung
Dass die Schulung der Leistungserbringenden den DiGA-Herstellern wichtig erscheint, ist nachvollziehbar (52%). Schließlich sollen die Ärztinnen und Ärzte die DiGA verordnen, zudem kommt ihnen aus Sicht der Hersteller eine Multiplikatorenrolle zu. Und da die Akzeptanz unter den Leistungserbringenden ohnehin als Hürde für Digital Health gesehen wird, wäre die Hebelwirkung groß, wenn man sie über die DiGA in den digitalen Transformationsprozess stärker einbeziehen könnte.
Die Leistungserbringenden selbst halten Schulungen allerdings nur zu 38% für wichtig. Das mag dem Umstand geschuldet sein, dass DiGA-Schulungen für sie nur eine weitere Verpflichtung in ihrem ohnehin schon übervollen Terminkalender wären. Vielleicht hängt der vergleichsweise niedrige Wert aber auch damit zusammen, dass Ärztinnen und Ärzte sich selbst insgesamt nicht als Profiteure von Digital Health betrachten und ihre Bereitschaft, eine DiGA zu verschreiben, mit 63% auch nicht allzu ausgeprägt ist (Radic et al. 2021). In einer Umfrage der BARMER gaben sogar nur 42% von 1.000 befragten Ärztinnen und Ärzten an, dass sie die Möglichkeit, eine App zu verschreiben, gut oder sehr gut finden (BARMER 2020).
Das ungenutzte Potenzial: die ePA als Heimathafen der DiGA
Mehrere befragte Gruppen im Innovationspanel halten die Einbindung von DiGA und deren Daten in die elektronische Patientenakte (ePA) für einen wichtigen Hebel, um eine größere Marktdurchdringung zu erreichen. Dies erscheint folgerichtig, wenn man DiGA auf eine Ebene mit Arzneimitteln stellt: Die ePA ist der richtige Ort für die Dokumentation von therapeutischen Maßnahmen, zu denen DiGA bekanntlich zählen. Verwunderlich ist eher, dass deren Einbindung in die elektronische Akte nicht mehr Zustimmung erhält. Bei den Teilnehmenden der Pharma- und Medizintechnikindustrie votierten 49% dafür, bei den Leistungserbringenden sind es sogar nur 33%. Dieser niedrige Wert könnte allerdings auch darin begründet sein, dass die ePA bei vielen Ärztinnen und Ärzten generell kein hohes Ansehen genießt: Einerseits fehlt bisher das Vertrauen in ihren Mehrwert, andererseits fürchten viele, dass damit zusätzliche Dokumentationspflichten einhergehen.
Dabei bietet die Integration von DiGA in die ePA zahlreiche Vorteile: Sie wären besser in ein therapeutisches Gesamtkonzept eingebunden und Behandlungseffekte deutlicher erkennbar. Zudem könnte auf diese Weise ein wertvoller Pool an Versorgungsdaten entstehen, der sowohl in die Gestaltung innovativer Versorgungsmodelle als auch in einen Erstattungsbetrag für DiGA einfließen könnte. Konsequent wäre es daher, auch den Zugangsweg zu digitalen Gesundheitsanwendungen über die ePA zu gestalten und diese so als Ökosystem der Versorgung auszubauen.
Nutzenszenarien aus Sicht der Akteure erforderlich
Insgesamt zeigen die Ergebnisse des Innovationspanels, dass die DiGA in eine komplexe Gemengelage unterschiedlicher Interessen und Prioritäten hineingeboren wurde. Dass eine große Mehrheit der Befragten vom Mehrwert der DiGA für die Patientinnen und Patienten überzeugt ist, ist eine gute Ausgangsbasis. Es reicht aber nicht, um das DiGA-Konzept zum Fliegen zu bringen. Ein notorischer Webfehler unseres Gesundheitssystems ist, dass keine Nutzenszenarien aus der Perspektive der beteiligten Akteure entworfen werden. Mit anderen Worten: Es fehlt der DiGA an einem durchdachten Geschäftsmodell. Das betrifft aber nicht sie allein – Geschäftsmodelle für Innovationen sind im Fünften Sozialgesetzbuch schlicht nicht vorgesehen.
Führt man sich den Vertriebsapparat vor Augen, der bei Pharmaunternehmen in Gang gesetzt wird, um ein neues Medikament im Markt zu platzieren, wirken DiGA geradezu vernachlässigt. Es ist klar, dass die meisten Start-ups hier finanziell nicht mithalten können. Umso kreativer gilt es deshalb zu werden, um neben Patientinnen und Patienten vor allem Kostenträger und Leistungserbringende von ihrem Produkt zu überzeugen.
Die Kommunikation von Evidenznachweisen muss dabei höchste Priorität haben (vgl. Lägel 2020c). Die Aufnahme in Behandlungsleitlinien wäre darüber hinaus der Goldstandard, der auch auf Krankenkassen eine überaus beruhigende Wirkung hätte. Für die Kostenträger ist die DiGA in dem Moment interessant, in dem sie beweist, dass sie ihr Geld wert ist, weil sie zu Einsparungen an anderer Stelle führt. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn sie dazu beiträgt, Chronifizierungen zu vermeiden, Krankheitsepisoden zu verkürzen oder die Steuerung von Patientinnen und Patienten durch das System zu verbessern. Ein großes Potenzial könnten DiGA aus der Perspektive der Krankenkassen entfalten, wenn sich durch sie Versorgungsengpässe abfedern ließen, (beispielsweise im Bereich psychischer Erkrankungen) oder Übergänge von stationären in ambulante Versorgungsstrukturen nahtloser gestaltet werden könnten (etwa im Bereich Physiotherapie nach einer Reha, bei Suchterkrankungen oder bei der Etablierung von Lebensstiländerungen).
Leistungserbringende wiederum sind, wie das Innovationspanel klar gezeigt hat, bislang am schwersten von digitalen Gesundheitslösungen zu überzeugen. Also gilt: Bei aller Liebe zu den Patientinnen und Patienten sollten DiGA-Hersteller den Nutzen für die Ärztinnen und Ärzte nicht ganz aus dem Blick verlieren. Eine DiGA mag noch so beeindruckende Funktionen haben: Erzeugt sie bei den Versorgenden spürbaren Mehraufwand, streben ihre Erfolgschancen gegen Null (Wangler u. Jansky 2020). Erschwerend kommt hinzu, dass für die Verordnung einer DiGA genau wie bei Arzneimitteln und anderen Medizinprodukten keine gesonderte Vergütung vorgesehen ist. Im Umkehrschluss heißt das: Das größte Potenzial haben diejenigen DiGA, die gleichzeitig zu einer verbesserten Versorgung und zu einer Zeitersparnis für die Versorgenden führen.
Zudem müssen die Hersteller aktiv auf Ärztinnen und Ärzte zugehen und ihnen die Informationen über das Produkt mundgerecht servieren, sei es im Rahmen von Schulungen oder über traditionelle Vertriebswege: Denn digitale Kommunikation mag in den DiGA-Schmieden selbstverständlich sein – in vielen Arztpraxen ist sie es noch nicht. Dort erhalten Broschüren in Papierform, Telefonanrufe oder Vor-Ort-Besuche häufig noch immer eine höhere Aufmerksamkeit als eine E-Mail.
Aufseiten der Politik schließlich muss es zunächst darum gehen, der DiGA einen angemessenen Zeitraum zu gewähren, um ihren Nutzen unter Beweis zu stellen.
Wenn aber die DiGA in derselben Liga spielen soll wie Arzneimittel, heißt das auch, dass der Umgang damit bereits im Medizinstudium erlernt werden muss. Das Vertrauen von Ärztinnen und Ärzten in die Wirkung von Medikamenten ist auch deshalb groß, weil ihre Anwendung schon im Studium eine Selbstverständlichkeit darstellt. DiGA sollten die Chance erhalten, sich dieses Vertrauen gleichermaßen zu erwerben. Hierzu dürfen wir nicht in Legislaturperioden planen, sondern sollten eher in Ärztegenerationen denken.
Fazit
Insgesamt muss die Politik einen Wandel anstoßen, der wegführt von einem fragmentierten Einzelleistungsgeschehen hin zu einem Denken in integrierten Versorgungskonzepten und Behandlungspfaden. Modellprojekte, Best-Practice-Beispiele und nicht zuletzt die Erfahrungen aus den Innovationsfondsprojekten haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt: Eine gut koordinierte und stärker steuernde Versorgung, die auf das Alltagssetting und die Lebensumstände der Patientinnen und Patienten abgestimmt ist, birgt ein immenses Potenzial für den gesundheitlichen Mehrwert und die Lebensqualität. DiGA bieten hier eine große Chance, denn derzeit lässt sich kaum eine Therapieform flexibler in den Alltag einbetten als die, die man in Form des Smartphones in der Hosentasche mitführt.
Eine wichtige Strategie dürfte für die Hersteller deshalb zum einen in der Beteiligung an integrierten Versorgungsmodellen liegen. Zum anderen kann die DiGA Mehrwert „beyond“ und „around the pill“ generieren – also um die klassische Arzneimittelversorgung herum. Denn das beste Medikament ist wirkungslos, wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosis eingenommen beziehungsweise angewendet wird (Amelung u. Ex 2019b).
Mit anderen Worten: Das Erfolgsrezept für eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung, in der auch die DiGA ihren Beitrag leistet, dürfte in der Gestaltung von Wertschöpfungsketten liegen. Dieser Ansatz wird aber nur funktionieren, wenn er von neuen Finanzierungsmodellen flankiert wird, beispielsweise in Form von Bundled Payments. Eine Vergütung von definierten Episoden der Versorgung, etwa für die Diabetesversorgung innerhalb eines Fünfjahreszeitraums, bietet den Vorteil, dass die Versorgung aus individuell angepassten Bausteinen konzipiert werden kann. Das schafft Planungssicherheit bei den Leistungserbringenden und lässt gleichzeitig Raum für Innovationen, weil die Versorgenden unmittelbar von Verbesserungen partizipieren, sei es in Form von Entlastung durch bessere Prozesse oder in monetärer Hinsicht, weil Kosten eingespart werden.
Digitale Produkte stellen in solchen Szenarien unverzichtbare Bausteine dar. Sie können Wertschöpfungsketten erweitern und die einzelnen Versorgungskomponenten miteinander vernetzen. Wenn wir die DiGA in diese Versorgungslandschaft einpflanzen, wird sie gedeihen und Früchte tragen.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Amelung VE, Ex P (2021a) Wann werden digitale Gesundheitsanwendungen erfolgreich? In: Jorzig, A., Matusiewicz, D. (Hrsg.) Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA). Rechtliche Grundlagen, innovative Technologien und smarte Köpfe. 125–134. Medhochzwei Heidelberg
Amelung VE, Ex P (2021b) Ohne Geschäftsmodelle fliegt Digital Health nicht. Frankfurter Allgemeine Zeitung. URL: https://www.faz.net/asv/die-zukunft-der-medizin-ist-digital/ohne-geschaeftsmodelle-fliegt-digital-health-nicht-16473677.html (abgerufen am 15.09.2021)
BARMER (2020) BARMER-Umfrage zu Gesundheits-Apps – Ärzte stehen digitalen Helfern offen gegenüber. URL: https://www.barmer.de/presse/presseinformationen/pressemitteilungen/barmer-umfrage-zu-gesundheits-apps—aerzte-stehen-digitalen-helfern-offen-gegenueber-247444 (abgerufen am 15.09.2021)
Brönneke JB, Debatin JF, Hagen J, Kircher P, Matthies H (2020) DiGA Vademecum. Was man zu Digitalen Gesundheitsanwendungen wissen muss. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin
Health Innovation Hub (2021) Ein Jahr DiGA Fast Track – Wo stehen wir und was kommt? URL: https://hih-2025.de/gesundheit_digital-meilensteine-fuer-eine-digitale-medizin/ (abgerufen am 15.09.2021)
Lägel R (2020a) DVG, DiGAs und ein Blick über den deutschen Tellerand – Zum Status quo der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Gesundheitsforen Trend-Dossier
Lägel R (2020b) App auf Rezept. Market Access & Health Policy 04/20: 28–31
Lägel R (2020c) So kommen Apps in die GKV-Erstattung. Market Access & Health Policy 02/20: 26–28
Lägel R, Amelung VE (2019) Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) – Herausforderung und Chance für die pharmazeutische Industrie? Market Access & Health Policy 06/19: 29–31
Radic M, Brinkmann C, Radic D (2021) Digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept: Wie steht es um die Akzeptanz in der Ärzteschaft? Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW. URL: https://www.imw.fraunhofer.de/content/dam/moez/de/documents/210303_Studie_Digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept_DiGAs.pdf (abgerufen am 15.09.2021)
Wangler J, Jansky M (2020) Welchen Nutzen bringen Gesundheits-Apps für die Primärversorgung? Ergebnisse einer Befragung von Allgemeinmedizinern. Prävention und Gesundheitsförderung, 16(2), 150–156. DOI: https://doi.org/10.1007/s11553-020-00797-7 (abgerufen am 15.09.2021)